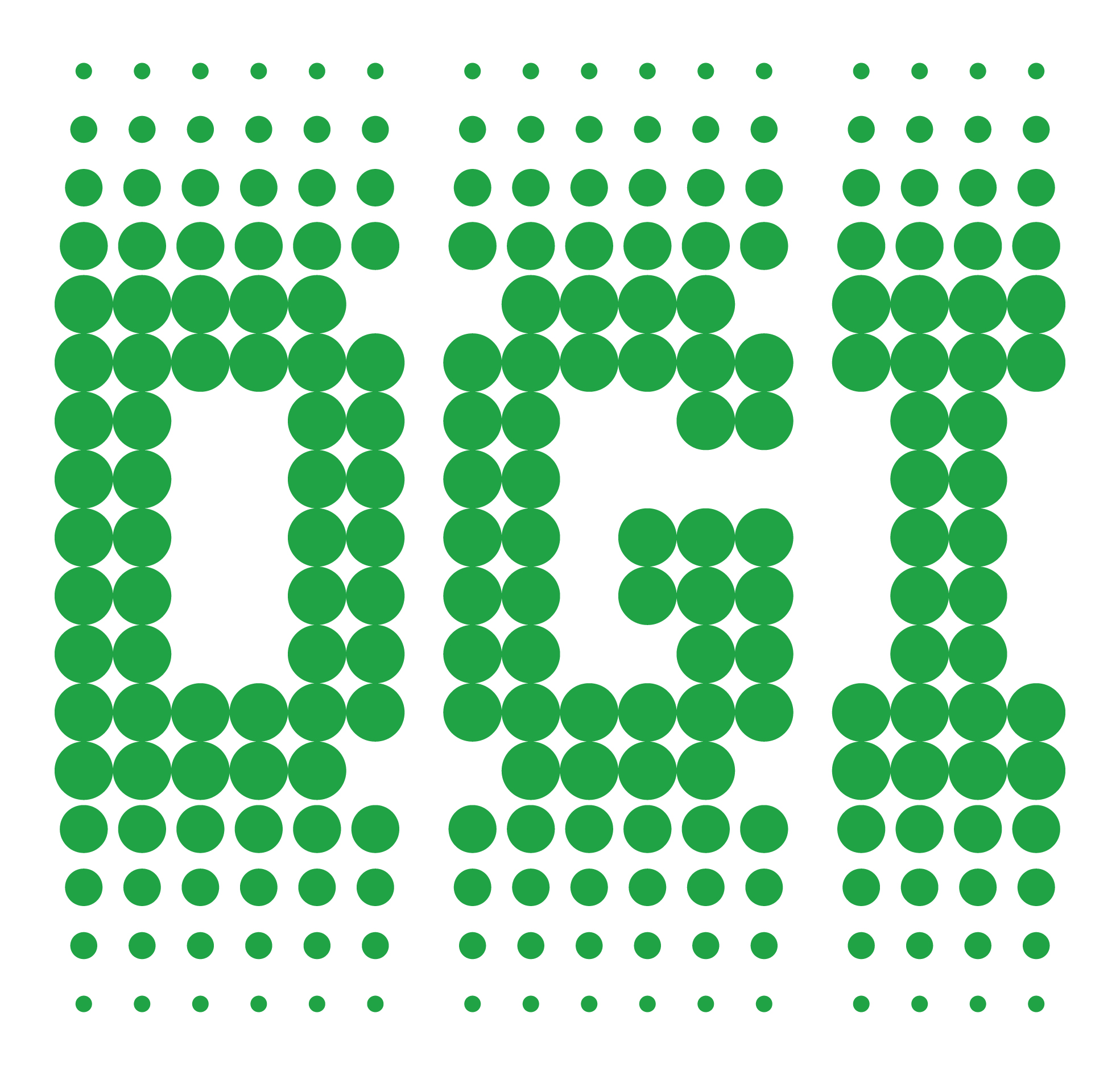🎯 Quo Vadis DGI? Strategieworkshop erfolgreich durchgeführt 🎯
Liebe Mitglieder und Freunde der DGI, Wie sieht die Planung in 2024 und darüber hinaus aus? Was ist uns und unseren Mitgliedern auch in Zukunft wichtig? Welche Weichen müssen jetzt gestellt werden, um unsere Fachgesellschaft und deren Bedeutung in der Community nachhaltig zu sichern? Am 21.06.2024 haben wir wichtige Themen